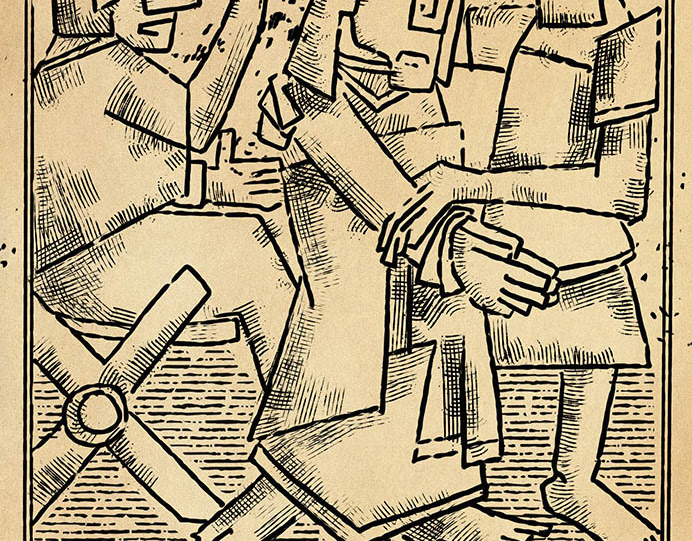„Ecce Scaena“ & „Auferstehung – Christus in Bewegung“
Ein Diptychon über Schmerz und Hoffnung

Kreuzigung & Auferstehung (Ecce Scaena) - Diptychon linke Tafel - 50 x 60 cm - Acryl auf Leinwand

Kreuzigung & Auferstehung (Auferstehung- Christus in Bewegung) - Diptychon rechte Tafel - 30 x 60 cm - Acryl auf Leinwand
Mit diesem zweiteiligen Werkzyklus – bestehend aus „Ecce Scaena“ (links) und „Auferstehung – Christus in Bewegung“ (rechts) – stelle ich das zentrale Geschehen der christlichen Heilsgeschichte in eine neue, visuell zugespitzte und zugleich theatralisch verdichtete Form. Die beiden Bilder sind nicht bloß aufeinanderfolgende Episoden – sie sind Gegenpole in Spannung: Tod und Leben, Bühne und Aufbruch, Dunkelheit und Licht.
Teil 1: „Ecce Scaena – Die Kreuzigung als Bühnenstück“
Die Kreuzigung Christi ist hier kein ikonografisch entrücktes Heilsgeschehen, sondern eine bitter-scharfe Inszenierung. Auf hölzernem Bühnenboden vollzieht sich ein Drama, das von Schuld, Machtverleugnung und spiritueller Einsamkeit handelt. Die Gestalt Jesu hängt, entstellt, verzerrt – seine Haut ist grünlich, seine Wunden dunkelrot, sein Blick leer. Alles wirkt aufgeladen, kantig, beinahe wie ein Schnitt durch das Fleisch der Geschichte.
Links am Bildrand tritt Pontius Pilatus nochmals auf – mit leerem Blick und gewaschenen Händen. Dass seine Figur doppelt erscheint, verweist auf die Wiederholbarkeit von Verantwortungslosigkeit im Angesicht des Unrechts.
Zwei Kerzen rahmen das Geschehen symbolisch: links ausgelöscht, rechts brennend – Tod und Leben. Die Bühne ersetzt den Ort Golgatha. Das Geschehen wird vorgeführt – und wir sind die Zuschauer.
Stilistisch orientiert sich das Werk an der körperlichen Radikalität des Isenheimer Altars von Matthias Grünewald, an der existenziellen Bildsprache eines Max Beckmann, und an der bitteren sozialen Schärfe von Otto Dix. Verzerrung ist hier kein Selbstzweck, sondern ein Mittel der Wahrhaftigkeit. Der Schmerz ist kantig, sichtbar, ungeschönt.
Teil 2: „Auferstehung – Christus in Bewegung“
Rechts im Diptychon steht die Antwort auf das Geschehen der Kreuzigung: der Auferstandene Christus – losgelöst vom Boden, schwebend, segnend, mit Wundmalen, aber in neuer Würde. Sein rotes Gewand ist kraftvoll und lebendig. Die Segensgeste seiner rechten Hand verweist auf Dreifaltigkeit und inneren Frieden – sie steht im Kontrast zur zerrissenen Körperhaltung des Gekreuzigten.
Besonders eindrücklich ist die Osterfahne, die sich wie ein lebendiges Band um die Gestalt Christi windet – nicht als bloßes Attribut, sondern als dynamisches Element, das seine Bewegung begleitet. Sie verweist auf Triumph, aber auch auf die Weitergabe der Botschaft. Die Figur ist nicht statisch, sondern erscheint im Übergang – zwischen Erscheinen und Verschwinden, zwischen Himmel und Erde.
Umgeben ist Christus von einer Art strahlendem Nachbild – gezackte Konturen und Lichtlinien deuten seine geistige Präsenz an. Die Farbtöne des Hintergrunds bleiben neutral, fast erdig – denn das Licht kommt aus der Figur selbst.

Kreuzigung & Auferstehung (Ecce Scaena) - Diptychon linke Tafel - Digitale Rötelskizze

Kreuzigung & Auferstehung (Auferstehung - Christus in Bewegung) - Diptychon rechte Tafel - Digitale Rötelskizze
„Christus und Pilatus“ – nach Beckmann
"Christus und Pilatus" Adaption nach Max Beckmann - Öl auf Leinwand - 50 x 60 cm - 1985
„Was ist Wahrheit?“ – Mit dieser berühmten Frage endet die Begegnung zwischen Pontius Pilatus und Jesus im Johannesevangelium (Joh 18,38). Es ist ein Satz, der in seiner sprachlichen Knappheit eine ganze theologische Tiefendimension öffnet – und zugleich ein machtpolitisches Ausweichen offenbart. In dieser Szene entscheidet sich nicht nur das Schicksal Jesu, sondern auch die Haltung der Welt zur Wahrheit, zur Verantwortung, zur Menschlichkeit.
In meiner malerischen Adaption von Max Beckmanns Lithografie „Christus und Pilatus“ habe ich diese dichte, existenzielle Konstellation aufgegriffen – nicht als Reproduktion, sondern als freie, malerisch interpretierte Transformation.
Beckmanns Gestus – und meine Übersetzung
Beckmanns Original aus den 1930er Jahren ist ein grafisches Kammerspiel in Schwarz-Weiß, voller psychologischer Spannung und düsterer Verdichtung. Die Gesichter seiner Figuren sind verzerrt, fast maschinenhaft, die Atmosphäre ist klaustrophobisch. Er denkt die Passion als politische Anklage gegen die Zeitläufe des 20. Jahrhunderts – gegen Opportunismus, Macht, Schuldabwehr.
In meiner Übersetzung ins Öl habe ich Beckmanns formale Strenge aufgenommen, aber farblich und malerisch neu akzentuiert. Die Farbfelder sind reduziert: kühle Grautöne, gebrochene Hautfarben, ein Blutrot im Gewand Christi – als leiser Hinweis auf das bevorstehende Opfer. Der Hintergrund bleibt reduziert, fast leer, doch das Fenster mit bläulichem Licht öffnet eine symbolische Dimension: Es gibt noch eine Welt jenseits des Machtspiels.
Die Figuren – Konfrontation ohne Dialog
Christus ist frontal, entrückt, fast geisterhaft dargestellt. Sein Gesicht wirkt langgezogen, eingefallen, die Augenhöhlen schwarz – als hätte ihn die Passion schon erfasst. Er spricht nicht mehr – seine Haltung ist still, leidend, unaufgeregt. Die Dornenkrone wirkt wie ein metallisches Objekt, ein Instrument, das nicht nur verletzt, sondern deformiert.
Pilatus hingegen – glatt, weltlich, stolz. Seine Rüstung glänzt nicht, sie schützt. Sein Mund ist hervorgewölbt, das Kinn markant, seine Haltung aggressiv nah. Zwischen den beiden: keine echte Kommunikation, nur Blickachsen, Spannungen, Ungesagtes. Die Geste von Christi Hand auf Pilatus’ Schulter ist mehrdeutig: Ist es ein Zeichen der Vergebung? Eine letzte Berührung? Oder ein Akt des Abschieds?
Theologische Tiefe
Die Szene nach Johannes 18 ist einzigartig unter den Evangelien: Hier begegnet sich Wahrheit und Macht in Person. Christus sagt: „Ich bin gekommen, um Zeugnis für die Wahrheit abzulegen.“ Pilatus antwortet nicht mit einem Argument – sondern mit einer rhetorischen Ausflucht: „Was ist Wahrheit?“
Dieses Gemälde macht diese Spannung sichtbar. Es ist kein Dialogbild, sondern ein Antlitz der Unfähigkeit zur Wahrheit. Christus steht für das Licht, das nicht erkannt wird. Pilatus für die Welt, die lieber urteilt, als versteht.
Das Fenster im Hintergrund bleibt offen – ein mögliches Jenseits der Szene, ein Ort, den keiner der beiden betreten kann.
Ein Werk zwischen Zeiten
Indem ich Beckmanns Komposition aufnehme und malerisch überführe, verschiebt sich auch der historische Kontext: Die Szene bleibt zeitlos. Sie kann gelesen werden als Spiegel heutiger Diskurse: Wahrheit wird verhandelt, verzerrt, relativiert. Wer spricht sie aus? Wer wäscht sich die Hände?
Fazit
Mit meiner Adaption von „Christus vor Pilatus“ stelle ich eine Begegnung in den Mittelpunkt, die weniger von Worten als von Blicken lebt. Es geht um Nähe und Distanz, um Macht und Ohnmacht, um Wahrheit und Weltflucht. Beckmanns Einfluss bleibt sichtbar – doch das Medium Malerei bringt eine neue Körperlichkeit, eine neue Stille in die Szene.
Ein Bild, das nicht antwortet – sondern zurückfragt.
Ein Bild über den Moment, in dem das Urteil fällt –
und die Wahrheit schweigt.
Ein Bild über den Moment, in dem das Urteil fällt –
und die Wahrheit schweigt.
„Der ungläubige Thomas“ – Glaube zwischen Sehen und Berühren

Der ungläubige Thomas - Acryl auf Leinwand - 50 x 60 cm - 2024

Der ungläubige Thomas - Digitale Rötelskizze - 2024
„Reiche deinen Finger her und sieh meine Hände; und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite; und sei nicht ungläubig, sondern gläubig!“
(Joh 20,27)
(Joh 20,27)
Diese berühmte Szene aus dem Johannesevangelium zählt zu den unmittelbarsten Christusbegegnungen nach der Auferstehung. Sie verbindet Zweifel, Körperlichkeit und Offenbarung auf eine Weise, die seit Jahrhunderten Künstlerinnen und Theologinnen gleichermaßen herausfordert. In meiner Interpretation habe ich versucht, diesen Moment der Berührung zwischen Zweifel und Gewissheit in eine stilisierte, archaisch-expressive Form zu bringen – roh, unmittelbar, fast kindlich-naiv, aber gerade darin kraftvoll.
Thomas kniet – aber er tastet auch
Die Figur des Thomas erscheint in dieser Darstellung kleiner, gedrungener, tastend. Seine Haltung ist gebückt, das Knie liegt schwer am Boden. Sein Ausdruck aber ist nicht flehentlich, sondern konzentriert, ernst – der Blick ist forschend, nicht verzückt. Seine rechte Hand tastet zielgerichtet in die Seitenwunde des Auferstandenen – eine Geste, die im Zentrum des Bildes steht. Sie verweist auf die Sehnsucht nach Gewissheit, aber auch auf die Unfähigkeit, nur mit dem Herzen zu glauben.
Die Farbwahl seines Gewandes – ein intensives, leuchtendes Grün – symbolisiert Lebendigkeit, Hoffnung, aber auch das „Wachsen“ des Glaubens: Thomas ist derjenige, der durch das Berühren lernt zu glauben. Der Gürtel, der seine Tunika zusammenhält, wirkt wie ein funktionales Symbol: Er hält ihn zusammen – obwohl der Glaube ihn gerade überfordert.
Christus – der Geöffnete
Der Auferstandene steht ruhig, beinahe stoisch. Seine Körperhaltung ist frontal, sein Blick ernst, fast traurig. Die Seitenwunde, die seine linke Flanke durchzieht, ist blutrot geöffnet – nicht als Verletzung, sondern als Einladung. Der Blick Christi wirkt nicht triumphierend, sondern verständnisvoll – und zugleich mahnend. Seine Hände zeigen die Wundmale, seine Füße ebenfalls. Die offene Körperlichkeit kontrastiert mit der Würde seiner Haltung. Christus präsentiert sich als lebendige Wunde, nicht als glorifizierter Sieger.
Die rechte Hand hält die Auferstehungsfahne mit dem roten Kreuz – ein altes christliches Symbol für den Sieg des Lebens über den Tod. Doch auch dieses Zeichen ist nicht überhöht – die Flagge wirkt fast schwer, als müsse sie mitgetragen werden. Die ganze Erscheinung bleibt geerdet.
Formensprache – klar, kantig, symbolisch
Wie in anderen Werken dieser Serie greife ich auf eine stilisierte, kantig-grafische Formensprache zurück, die bewusst an mittelalterliche Tafelmalerei, expressionistische Holzschnitte und naive Maltraditionen erinnert. Die Gesichter sind eckig, verzerrt, die Augen mandelförmig, fast maskenhaft. Die Umrisslinien sind schwarz konturiert, die Farbfelder klar voneinander getrennt.
Der Hintergrund ist neutral gehalten – er verzichtet auf jede Raumillusion zugunsten einer ikonengleichen Konzentration auf die Begegnung. Es gibt kein „Außen“, kein Publikum – nur den leibhaftigen Christus und den suchenden Menschen. Das Zentrum ist die Berührung, die wie ein Blitzpunkt zwischen den Figuren steht.
Theologische Deutung
Die Szene zeigt den entscheidenden Übergang vom Zweifel zum Glauben. Thomas steht für die Rationalität, für die Sehnsucht nach Beweisen – und zugleich für die existenzielle Tiefe des Glaubensweges. Jesus scheut sich nicht, seinen verwundeten Leib zu zeigen – Glaube darf durch das Konkrete wachsen, durch Erfahrung, durch Berührung.
Christus fordert nicht blinden Gehorsam – er lässt sich anfassen, prüfen, bezeugen. Und doch steht am Ende nicht die Berührung, sondern das Bekenntnis: „Mein Herr und mein Gott!“ (Joh 20,28)
Fazit
Dieses Bild ist kein Triumphbild, sondern ein Denkbild. Es stellt die Frage: Worauf gründet unser Glaube? Auf Berührung? Auf Erfahrung? Oder auf Vertrauen?
In einer Zeit, in der viele wie Thomas „sehen wollen, um glauben zu können“, verweist das Bild auf die Einladung Christi: „Komm näher, und zweifle nicht.“
In einer Zeit, in der viele wie Thomas „sehen wollen, um glauben zu können“, verweist das Bild auf die Einladung Christi: „Komm näher, und zweifle nicht.“
In der Spannung zwischen der tastenden Hand und der stillen Offenheit Christi liegt das eigentliche Wunder – dass Zweifel nicht das Gegenteil von Glauben ist, sondern oft sein Anfang.